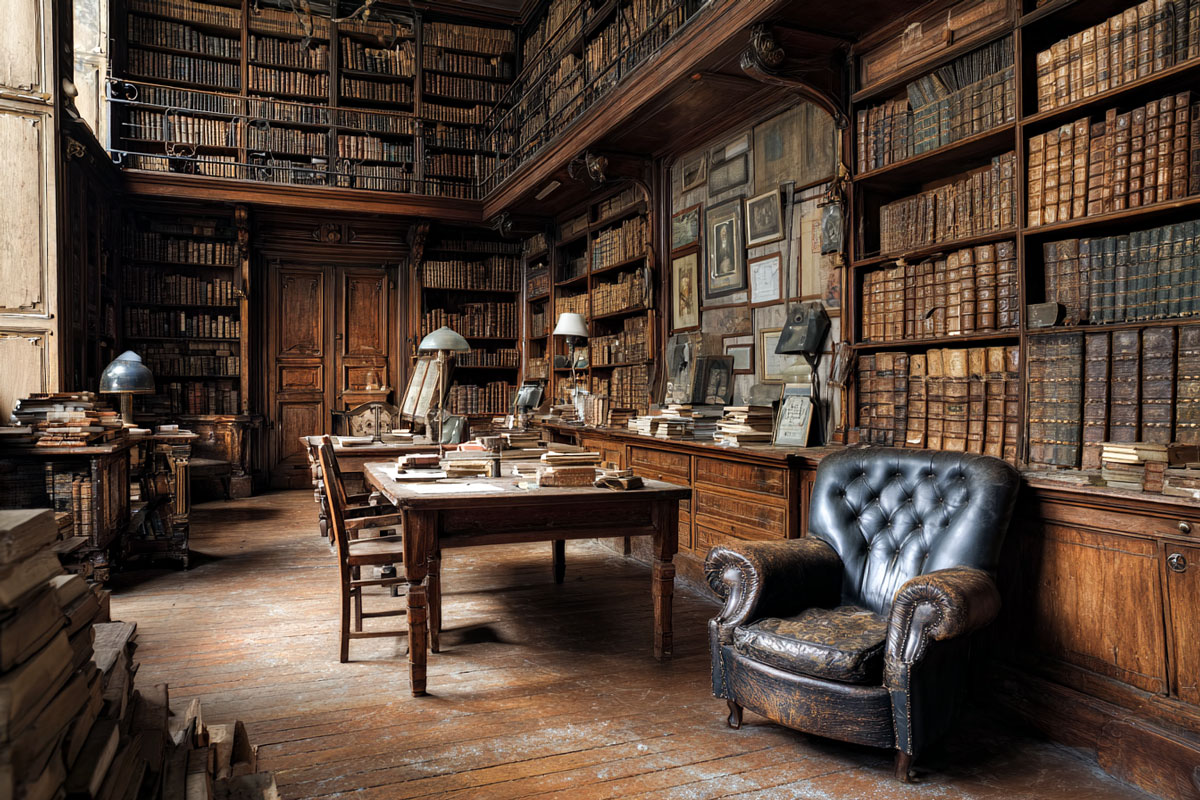Veraltete Informationen sind bestenfalls nutzlos. Oft verursachen sie aber auch Frust, unnötige Arbeit, finanzielle Schäden oder Schlimmeres. Ein Intranet oder Wiki aktuell zu halten ist deshalb eine zentrale Aufgabe für das Wissensmanagement. In Zeiten, wo die Menge an Informationen zu- und deren Halbwertzeit abnimmt, ist das allerdings ein schwieriges Unterfangen. In diesem Artikel geht es um praxistaugliche Methoden, wie man eine Wissenbasis trotzdem aktuell halten kann.
Stellen wir uns folgende Situation vor: Ein junger Assistenzarzt hat Nachtdienst im Spital. Ein schwer kranker Patient liegt auf seiner Abteilung. In der Verordnung der leitenden Ärztin steht, dass bei einer Verschlechterung des Zustands gemäss Reglement XY vorzugehen sei. Der Patient verschlechtert sich, der Assistenzarzt findet das Reglement XY im Intranet und folgt den entsprechenden Anweisungen.
Was er nicht weiss (und die leitende Ärztin nicht nachgeprüft hat): Das Reglement XY ist nicht auf dem neusten Stand. Eine kürzlich veröffentlichte Studie hat nämlich gezeigt, dass die bisherige Behandlungsmethode schwere Nebenwirkungen haben kann, worauf das Bundesamt für Gesundheit seine Empfehlungen in einigen entscheidenden Punkten angepasst hat. Diese Anpassungen sind aber nicht in das Reglement XY eingeflossen, und deshalb wird unser Patient nun falsch behandelt – im schlimmsten Fall mit tödlichen Folgen.
Zugegeben: Das ist ein Extrembeispiel. Aber auch wenn man im einem Beruf arbeitet, bei dem es nicht um Leben und Tod geht, ist es wichtig, dass man sich auf die Informationen verlassen kann, die man auf dem Server, im Sharepoint, im Intranet, im Wiki oder in der Wissensdatenbank seines Unternehmens findet. Wie also können wir sicherstellen, dass diese Informationen immer auf dem neusten Stand sind?
Informationen konsequent datieren
Wenn man die Aktualität von Informationen beurteilen muss, ist es ungemein hilfreich, wenn diese datiert sind. Wir sollten deshalb sicherstellen, dass jedes Dokument und jeder Wiki-Eintrag mit dem Erstellungs- bzw. Freigabedatum versehen ist. Auch wenn Informationen später überprüft und ggf. überarbeitet werden, muss dies mit Datum vermerkt werden.
Mit dieser einfachen Massnahme erreichen wir zwei Dinge:
- Erstens geben wir allen Personen, die eine Information nutzen, einen Indikator, ob sie sich darauf verlassen können, dass die Information aktuell ist – oder ob sie allenfalls weitere Abklärungen treffen müssen. Wenn ein Merkblatt zum Datenschutz aus dem Jahr 2012 stammt, dann dürfte die meisten Benutzer:innen realisieren, dass dieses wohl nicht mehr aktuell ist, auch wenn sie nicht im Detail über DSGVO und nDSG Bescheid wissen. Steht darunter allerdings «Revidiert am 1.9.2023 (Änderungen gemäss nDSG)», dann wird klar, dass die Informationen wahrscheinlich auf dem neusten Stand ist.
- Zweitens schaffen wir durch die Datierung die Grundlage für die periodische Durchsicht unseres Informationsbestands, über die wir später noch sprechen werden. Wenn in unserem Unternehmen die Regel gelten soll, dass alle Richtlinien, Wegleitungen und Merkblätter einmal jährlich überprüft werden, dann ist das nur machbar, wenn diese Dokumente datiert sind.
Jede Information hat eine verantwortliche Person
Die Chancen, dass Informationen aktuell gehalten werden, sind wesentlich höher, wenn jemand für sie verantwortlich ist. Der Name dieser Person (wir sprechen in diesem Zusammenhang meist vom «Owner») sollte auf jedem Dokument, auf jeder Intranet-Seite und in jedem Wiki-Artikel an prominenter Stelle vermerkt sein. So wissen nicht nur die betreffenden Personen selbst, sondern alle Mitarbeitenden, wer zuständig ist, falls eine Information nicht mehr aktuell ist oder falls es sonstige Verbesserungsvorschläge gibt.
Den Owner einer Information zu definieren hat folgende Vorteile:
- Gegenüber dem Owner stellen wir klar, dass er die Information bei Bedarf aktualisieren muss – aber auch, dass er sie aktualisieren darf. Letzteres ist wichtiger, als man denkt: Häufig bleiben veraltete Informationen deshalb bestehen, weil niemand so recht weiss, ob man diese selbst anpassen darf; im Zweifelsfall lässt man es dann bleiben.
- Allen anderen Mitarbeitenden signalisieren wir, wer die Ansprechperson für alle Fragen und Verbesserungsvorschläge zu diesem Thema ist. Wir fördern so den direkten Dialog mit den Spezialist:innen, was generell ein wichtiges Anliegen des Wissensmanagements ist. Aufgrund der Anfragen, die sie erhalten, erkennen Owners unter Umständen auch, wenn sie eine Information unklar oder unvollständig dokumentiert haben und können entsprechende Verbesserungen vornehmen.
Das Ganze funktioniert allerdings nur dann, wenn der Owner noch im Unternehmen tätig ist. Verlassen Mitarbeitende das Unternehmen, muss sichergestellt sein, dass sie ihre Ownership auf andere Mitarbeitende übertragen – andernfalls sind die betreffenden Information verwaist und werden nicht mehr aktualisiert.
Informationen periodisch überprüfen
Wenn man veraltete Informationen ernsthaft bekämpfen will, dann führt kein Weg daran vorbei, dass man alle Informationen periodisch überprüft. Je nach Umfang des Informationsbestands ist eine solche Überprüfung allerdings sehr zeitintensiv, und sie gehört wohl auch nicht zu den bevorzugten Tätigkeiten der Mitarbeitenden. Mit anderen Worten: Das Risiko, dass diese Überprüfung nicht oder nicht gründlich gemacht wird, ist hoch.
Mit den folgenden Strategien können wir dieses Risiko reduzieren:
- Wir erklären die Überprüfung nicht zur gemeinschaftlichen Aufgabe des Unternehmens, der Abteilungen oder der Teams, sondern wir nehmen die Owners in die Pflicht.
- Wir verlangen, dass die Überprüfung protokolliert wird: In jedem Dokument, auf jeder Intranet-Seite und in jedem Wiki-Artikel soll jede Überprüfung mit Name und Datum vermerkt werden.
- Wir überprüfen nicht sämtliche Informationen im gleichen Zeitabstand, sondern passen das Intervall der jeweiligen Information an. Unternehmenskritische Informationen, die erfahrungsgemäss schnell ändern, werden vielleicht halbjährlich überprüft – solche mit geringer Relevanz oder langfristiger Gültigkeit vielleicht nur alle 12 oder 24 Monate. Das Überprüfungsintervall vermerken wir am besten direkt im jeweiligen Dokument. Zudem kennzeichnen wir Informationen, die man generell nicht überprüfen muss, weil wir sie niemals anpassen werden – Protokolle, Medienmitteilungen oder abgeschlossene Verträge sind Beispiele dafür. Mit diesen Massnahmen setzen wir Prioritäten und reduzieren die Arbeitslast für die Owners.
Der ganze Prozess wird wesentlich einfacher und zuverlässiger, wenn die Owners die zur Überprüfung fälligen Informationen nicht manuell zusammensuchen müssen. In Atlassian Confluence könnten wir beispielsweise eine Automatisierung einrichten, die einmal monatlich alle Seiten, die seit mindestens 12 Monaten nicht mehr bearbeitet wurden, mit dem Stichwort «Überprüfung fällig» kennzeichnet.
Veraltete Information kennzeichnen, aktualisieren, archivieren oder löschen?
Wichtig zu klären ist auch die Frage, wie die Owners mit den veralteten Informationen umgehen sollen, die sie finden. Grundsätzlich gibt es vier Möglichkeiten:
Kennzeichnen
Die einfachste Methode besteht darin, veraltete Informationen lediglich als solche zu kennzeichnen und nichts weiter zu unternehmen. Diese pragmatische Lösung empfiehlt sich insbesondere dann, wenn eine Information über die Zeit an Bedeutung verloren hat oder generell selten genutzt wird. Mit der Kennzeichnung signalisieren wir allfälligen Benutzer:innen, dass sie sich nicht blind auf die vorliegende Information verlassen dürfen und allenfalls den Owner kontaktieren sollten.
Aktualisieren
Wichtige und häufig genutzte Informationen werden wir in der Regel aktualisieren, damit unsere Dokumentation nützlich und vertrauenswürdig bleibt. In diesem Fall stellt sich lediglich die Frage, ob wir die alte Fassung überschreiben oder ob wir eine neue Version erstellen sollen.
Diese Entscheidung hängt davon ab, um welche Art von Information es sich handelt und in welcher Art von Organisation wir uns befinden. Wenn eine Behörde ein Reglement revidiert, dann muss die bisherige Fassung selbstverständlich weiterhin greifbar sein. Wenn hingegen ein KMU den Prozess der Spesenerfassung dokumentieren, dann haben frühere Versionen dieser Anleitung keinen grossen Wert.
Je nach dem, auf welcher technischen Plattform die Wissensdokumentation betrieben wird, muss man sich über diese Frage auch gar nicht so viele Gedanken machen: Cloud-Speicher wie Sharepoint oder Dropbox haben eine automatische Versionierung, so dass man bei Bedarf auf jede frühere Fassung eines Dokuments zugreifen kann. Ähnliches gilt für Wikis, die üblicherweise jede Änderung an einem Artikel protokollieren und bei Bedarf auch die Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen anzeigen können.
Archivieren
Wenn eine Information veraltet ist, aber nicht aktualisiert werden kann oder soll, dann sollte man sie in irgend einer Form archivieren, d.h. von den aktuellen Informationen trennen, damit sie nicht versehentlich weiterhin genutzt wird.
Wie man dies löst, hängt wiederum von der technischen Umgebung ab. Atlassian Confluence beispielsweise erlaubt es, einzelne Seiten auf Knopfdruck zu archivieren. Archivierte Seiten werden dann bei einer Volltextsuche nicht mehr gefunden (ausser man verlangt dies explizit). Sie können auch nicht mehr bearbeitet oder verlinkt werden, und sie erhalten eine entsprechende Kennzeichnung (die ggf. auch den Grund für die Archivierung nennt).
Werden Informationen dagegen in Form von Word-, PowerPoint- und PDF-Dokumenten auf einem Fileserver verwaltet, dann braucht es eine klare Regelung, wie diese Dokumente archiviert werden sollen. Gängige Methoden sind:
- Archivierte Dokumente werden lediglich über den Dateinamen als solche gekennzeichnet, beispielsweise durch ein vorangestelltes Sonderzeichen (z.B.
_oder$). - Archivierte Dokumente werden in einen Unterordner «Archiv» verschoben.
- Archivierte Dokumente werden aus der Ordnerstruktur entfernt und auf einem separaten Share verwaltet.
Löschen
Ob man veraltete Informationen löschen soll bzw. darf, hängt wieder stark von den jeweiligen Umständen ab.
Für das Löschen spricht, dass man damit zuverlässig verhindert, dass veraltete Informationen im Umlauf bleiben und allenfalls Schaden anrichten. Zudem schafft man Platz und Übersicht. Falls personenbezogene Daten involviert sind, kann es auch aus Datenschutzgründen sinnvoll sein, diese zu löschen.
Gegen das Löschen sprechen unter Umständen rechtliche Gründe. So haben Unternehmen eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht bei Buchhaltungs- und Steuer-Unterlagen. Auch bei Konflikten mit Kunden oder Mitarbeitenden ist es unter Umständen hilfreich, wenn ältere Informationen, die als Beweismittel dienen können, noch verfügbar sind. Manchmal ist es aber auch aus ganz anderen Gründen nützlich, wenn man weiterhin auf ältere Informationen zugreifen kann, die man einst für überflüssig gehalten hat.
Fazit
Veraltete Informationen in der internen Dokumentation sind zweifellos ein Problem. Angesichts der Dynamik der heutigen Welt wäre es allerdings naiv zu glauben, wir könnten unsere gesamte Wissensbasis immer auf dem aktuellen Stand halten. Andererseits können wir mit vergleichsweise einfachen Massnahmen sicherstellen, dass ein Grossteil der veralteten Informationen innert nützlicher Frist identifiziert und behandelt wird.