Know-how, Wissen, Information, Daten: In der heutigen Wirtschaft sind diese Faktoren zentral für den Unternehmenserfolg. In der Theorie ist uns das allen klar – aber in der Praxis tun sich viele Unternehmen schwer damit, Wissen zu managen. Warum ist das so? Und wie können Sie das Wissensmanagement in Ihrem Unternehmen ganz konkret angehen?
Was ist eigentlich Wissen?
Es lohnt sich, kurz darüber nachzudenken, was Wissen ist. Insbesondere sollten wir Wissen nicht mit Informationen oder mit Daten verwechseln. Denn Daten und Informationen gibt es in jedem Unternehmen mehr als genug – nicht umsonst sprechen wir von «Datenflut» und «Information Overload». Wissen dagegen ist ein rares Gut: In der Regel haben wir zu wenig davon – oder zumindest nicht das richtige.
Wissen ist das, was ein Mensch befähigt, Dinge zu tun, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ob Sie nun einen Impfstoff entwickeln, E-Bikes produzieren, ein Logistikunternehmen betreiben oder Finanzgeschäfte tätigen: Nur wenn Sie sehr genau wissen, wie das alles funktioniert, werden Sie erfolgreich sein. Und je komplexer die Welt wird, desto wichtiger wird Wissen.
Nun ist es aber so, dass Unternehmen rein gar nichts wissen. Wissen ist an Menschen gebunden – Unternehmen besitzen lediglich Daten und Informationen. Das Wissen eines Unternehmens steckt in den Köpfen seiner Mitarbeitenden. Und wenn diese kündigen, krank werden oder sterben, dann ist ihr Wissen verloren.
Was ist Wissensmanagement?
Wissen ist also eine zentrale Ressource. Es ist nur logisch, dass sie gemanagt werden muss – und zwar ähnlich methodisch und zielgerichtet, wie wir auch alle anderen Unternehmensressourcen managen.
Aber in der Praxis findet Wissensmanagement nur selten statt. Das ist umso erstaunlicher, als die meisten Unternehmen und Organisationen ganz offensichtlich fundamentale Probleme in diesem Bereich haben. «Wir verschwenden viel Zeit damit, Informationen zu suchen» oder «Erkenntnisse aus früheren Projekten fliessen kaum in neue Projekte ein» sind typische Aussagen, die wir immer wieder hören.
Dass Wissen nicht oder zu wenig gut gemanagt wird, hat verschiedene Gründe. Der wichtigste Grund ist der Mangel an Zeit und Geld. Das ist nachvollziehbar, denn Wissensmanagement erfordert Ressourcen. Andererseits kann man mit Wissensmanagement auch Zeit und Geld einsparen, weil Mitarbeitende schneller auf relevantes Wissen zugreifen können, was unproduktive Arbeit, Doppelspurigkeiten und Fehlentscheide reduziert.
Oft fehlt es aber schlicht und einfach am Verständnis, was Wissensmanagement eigentlich ist und wie man es ganz konkret implementiert. Auf einen einfachen Nenner gebracht, umfasst Wissensmanagement vier Elemente:
1. Wissen definieren
Auf der strategischen Ebene geht es zunächst darum, das unternehmenskritische Wissen zu definieren. Wissen ist unendlich, aber Unternehmensressourcen sind begrenzt, und deshalb ist es beim Wissensmanagement entscheidend, sich zu fokussieren. Unternehmenskritisch ist Wissen dann, wenn es a) unverzichtbar für die Geschäftstätigkeit ist und b) nicht ohne weiteres eingekauft bzw. outgesourct werden kann.
Hat man einmal das relevante Wissen definiert, braucht es eine Bewertung: Welches Wissen ist im Unternehmen vorhanden – und wo bestehen Lücken? Welches Wissen ist gesichert – und wo könnte eine Pensionierung oder ein Krankheitsfall das Unternehmen in ernsthafte Schwierigkeiten bringen? Hier lohnt es sich übrigens, die Mitarbeitenden zu befragen, denn Wissenslücken spüren diese oft viel direkter als das Management.
2. Wissen aufbauen oder beschaffen
Sind die Lücken im unternehmenskritischen Wissen einmal definiert, braucht es einen Plan, wie man diese Lücken schliesst. Denn eines steht fest: Verschwinden werden sie nicht von selbst – ohne Gegenmassnahmen werden sie eher grösser.
Grundsätzlich gibt es zwei Ansätze: Entweder bauen Sie das benötigte Wissen intern auf – oder sie beschaffen es auf dem Markt, indem sie neue Mitarbeitende mit entsprechenden Kompetenzen rekrutieren oder einen Partner finden.
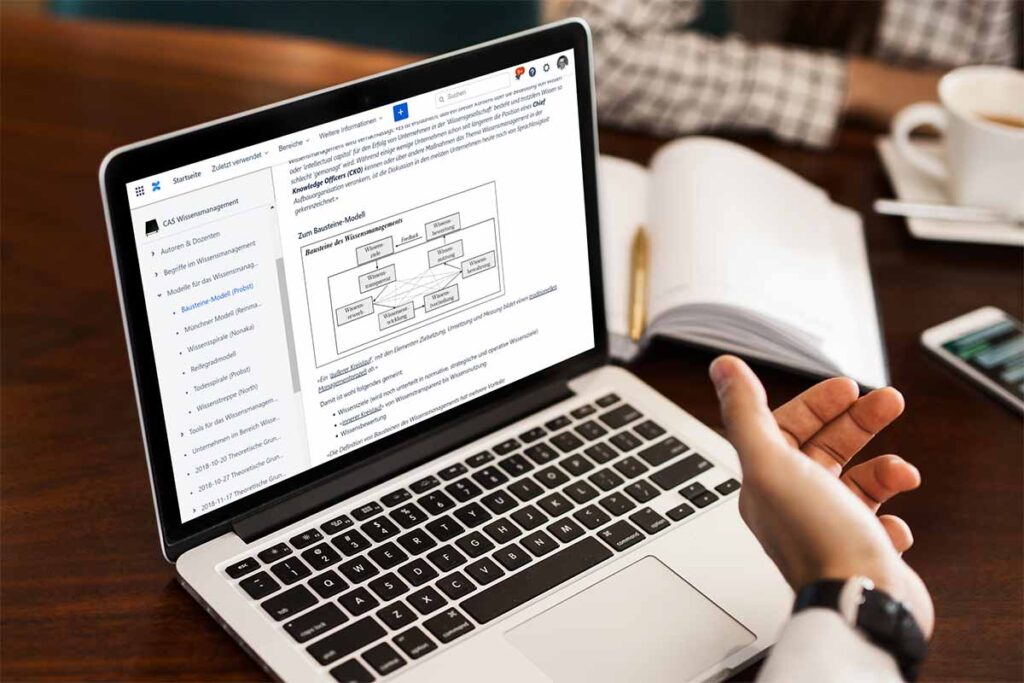
Wir beraten Sie beim Wissensmanagement
Martin Sauter, der Gründer von Metoki, ist Spezialist für Wissensmanagement. Als Chief Knowledge Officer eines Schweizer KMU hat er jahrelange Praxiserfahrung, und als Absolvent des CAS Wissensmanagement & Organisationales Lernen kennt er auch die theoretischen Grundlagen.
Gerne beraten wir Sie bezüglich Methoden und Software für das Knowledge Management in Ihrem Unternehmen. Zudem bieten wir individuelle Coachings für das persönliche Wissenmanagement.
3. Wissen verbreiten und nutzen
Wissen irgendwo im Unternehmen zu haben, ist grundsätzlich gut, aber noch immer nicht das Endziel des Wissensmanagements. Letztlich geht es darum, das Wissen im richtigen Moment am richtigen Ort verfügbar zu haben. Dazu muss man Mittel und Wege finden, wie das Wissen eines einzelnen Mitarbeitenden zu allen anderen Mitarbeitenden fliessen kann, die dieses Wissen ebenfalls benötigen.
Falls Sie jetzt an die Einführung einer digitalen Wissensplattform denken, wo man alles Unternehmenswissen abfragen kann, dann ist das naheliegend, aber nicht in jedem Fall die beste Lösung. Mindestens so wichtig ist der direkte Wissensaustausch von Mensch zu Mensch, zumal es viele Dinge gibt, die man nur schwer schriftlich festhalten kann. Das gilt etwa für manuelle Tätigkeiten, für soziale Interaktionen, aber auch für das sogenannte implizite Wissen, das dem Wissensträger gar nicht bewusst ist.
4. Wissen bewahren
Weil Wissen an Menschen gebunden ist, bedeutet der Verlust von Mitarbeitenden immer auch einen mehr oder weniger grossen Verlust an Wissen. Das ist nicht komplett zu vermeiden, aber man kann zumindest Gegenmassnahmen ergreifen.
Sofern der Abgang nicht völlig überraschend (Unfall oder Krankheit), sondern vorhersehbar (Kündigung oder Pensionierung) ist, bieten sich verschiedene Methoden des Wissenstransfers an. Hier geht es darum, das Wissen des Mitarbeitenden in einem strukturierten Prozess zu erschliessen und so für das Unternehmen auch in Zukunft nutzbar zu machen.
Das Dokumentieren von kritischem Wissen in einem Intranet, einem Wiki oder einer Wissensdatenbank ist – trotz der gerade gemachten Einschränkungen – selbstverständlich ebenfalls eine sinnvolle Massnahme. Dies muss allerdings systematisch und kontinuierlich betrieben werden. Als kurzfristige Massnahme beim Abschluss eines Arbeitsverhältnisses taugt es hingegen nicht. Einen scheidenden Mitarbeitenden zu bitten, «noch kurz das Wichtigste ins Wiki zu schreiben», zeugt von einem naiven Verständnis von Wissensmanagement.
Missverständnisse beim Thema Wissensmanagement
Oft führen Missverständnisse und falsche Vorstellungen dazu, dass man das Wissensmanagement entweder gar nicht erst angeht oder dass entsprechende Projekte scheitern. Hier eine Auswahl:
«Wenn wir schon Wissensmanagement machen, dann machen wir es richtig: Es muss das gesamte Wissen unseres Unternehmens umfassen und alle Mitarbeitenden einschliessen.»
Wenn eine Geschäftsleitung eine solche Ansage macht, versteht sie diese hoffentlich als langfristige Vision – nicht als ein konkretes Projekt, das in wenigen Monaten durchgepaukt werden muss. Denn wenn man mit einem derart universellen Anspruch an die Sache herangeht, dann ist das Risiko hoch, dass man scheitert.
Zunächst besteht die Gefahr, dass nach dem Top-Down-Prinzip entschieden wird, was Mitarbeitende zu wissen haben und in welcher Form dieses Wissen dokumentiert und vermittelt wird. So werden Wissensmanagement-Projekte an den Bedürfnissen der Mitarbeitenden vorbei geplant und später entsprechend schlecht genutzt. Erfahrungsgemäss sind Button-Up-Initiativen häufig erfolgreicher, also wenn einzelne Mitarbeitende und Teams ihre Werkzeuge und Methoden für den Wissensaustausch selbst entwickeln.
Des weiteren ist zu befürchten, dass unter diesen Voraussetzungen eine einheitliche Lösung für das ganze Unternehmen angestrebt wird. Gerade bei eher heterogenen Unternehmen sind solche Einheitslösungen aber nicht für alle Länder, Standorte, Abteilungen und Teams gleichermassen geeignet. Im schlimmsten Fall werden bestehende, gut funktionierende lokale Lösungen ersetzt, womit man dem Wissensmanagement einen Bärendienst leistet.
Schliesslich besteht die Gefahr, dass eine derartige Initiative zu einem IT-Projekt verkommt: Es wird für viel Geld eine Intranet-, Wiki- oder E-Learning-Plattform beschafft und ausgerollt, während die vielen anderen Aspekte des Wissensmanagements vernachlässigt werden.
«Wir haben unser Intranet – das Thema Wissensmanagement können wir also abhaken.»
Viel zu oft wird Wissensmanagement auf die Wissensdokumentation reduziert. Diese ist zwar notwendig, aber nicht ausreichend, wenn man ein umfassendes Wissensmanagement betreiben will.
Erstens kann man nur sogenanntes explizites Wissen dokumentieren. Implizites Wissen hingegen – das auf Erfahrung basiert und den Wissensträgern oft gar nicht bewusst ist – lässt sich so nicht fassen. Viele Dinge kann man deshalb aufgrund einer schriftlichen Anleitung nur schwer erlernen; erst wenn man jemandem über die Schulter schaut, der eine Sache schon beherrscht, erschliessen sich einem die entscheidenden Details. Nicht umsonst absolvieren angehende Ärzt:innen nach ihrem Medizinstudium zuerst eine längere Assistenzzeit. Auch viele manuelle und kommunikative Fähigkeiten kann man sich kaum aneignen, indem man nur darüber liest.
Zweitens ist das Suchen und Lesen von Dokumentationen nicht für alle Mitarbeitenden gleich einfach und naheliegend. In den meisten Unternehmen gibt es nicht nur Wissensarbeiter:innen, bei denen man dies voraussetzen darf. Wenn man Wissen an seine Chauffeure, Köche, Lageristen, Verkäufer, Mechaniker oder Hauswarte weitergeben möchte, hilft es wahrscheinlich wenig, nur ein entsprechendes Dokument ins Intranet zu stellen. Und selbst Wissensarbeiter:innen profitieren von Schulungen, Demonstrationen, Trainings, Erfahrungsgruppen und anderen Formen des persönlichen Wissenstransfers. Die Menschheit hat ihr Wissen schon weitergeben lange bevor sie die Schrift erfunden hatte. Die mündliche Tradition ist also wesentlich älter als die schriftliche, und auch heute noch funktioniert der direkte Wissensaustausch von Mensch zu Mensch oft besser.
«Wissensdokumentation funktioniert bei uns nicht: Unser Unternehmens-Wiki ist unvollständig und teilweise veraltet.»
Sei es ein Unternehmenshandbuch, ein Intranet, die Dateiablage auf dem Server, eine Wissensdatenbank oder ein Wiki: Solche Dokumentationen sind nie vollständig und nie durchgehend aktuell. Das kann gar nicht anders sein: Wissen nimmt laufend zu und verändert sich permanent – seine Dokumentation hinkt zwangsläufig hinterher, zumal die Ressourcen für das Wissensmanagement begrenzt sind.
Perfektionismus ist beim Wissensmanagement fehl am Platz. Auch wenn ein Wiki unvollständig und teilweise veraltet ist, kann es in vielen Fällen hilfreich sein – einfach nicht in allen Fällen. Es ist sicher kein Grund, die Wissensdokumentation für gescheitert zu erklären. Im Gegenteil: Es ist die Gelegenheit, um Strukturen und Prozesse zu etablieren, damit das Wiki kontinuierlich gepflegt wird. Denn die meisten Wissensdokumentationen kranken daran, dass sie einmal angelegt und dann sich selbst überlassen werden. Wissensmanagement ist aber kein einmaliges Projekt, sondern ein dauerhafter Prozess.

